Ausgedehnte LeerstelleMit der Frage " wie ausgedehnt ist eine Leerstelle " verbindet sich folgendes Modell: Durch die Lücke im Kristallgitter können die Nachbaratome jeweils etwas in diesen freien Bereich "rutschen". Die Bindungsabstände der Nachbaratome zum restlichen Gitter weiten sich, der Abstand zwischen den Nachbaratomen über die Lücke hinweg wird kleiner. Schließlich ist die einzelne Lücke nicht mehr an einem Gitterplatz lokalisiert, sondern in einen größeren Bereich verteilt. Im Prinzip könnte die Leerstelle immer über größere Bereiche ( > 10 benachbarte Atome) "ausgeschmiert sein, so daß die Atome jeweils nur eine kleine relative Verschiebung zu ihrer Umgebung erfahren. Das betroffene Gebiet erschien dann wie ein amorpher oder flüssiger Bereich (Flüßigkeiten haben in der Regel geringere Dichten als Festkörper), mit leicht vergrößerten Atomabständen (z. B. 26 Atome im Gebiet von 27 Gitterpositionen). Die Umordnung verliefe so, daß die Gitterstruktur verloren geht, aber lokal jedes Atom seine volle Anzahl Nachbarn in annähernd Gleichgewichtsabstand hat. Schematisches Beispiel: Drei Nachbaratome einer Leerstelle ordnen sich so an, daß sie im Bereich von vier Gitterplätzen angeordnet sind (die Atome liegen nicht mehr exakt auf Gitterpositionen!). Siehe hierzu das Bild mit den angedeuteten alten Atompositionen. Wenn die dei Atome rechts dasselbe tun würden, wäre dei Leerstelle fast "unsichtbar". 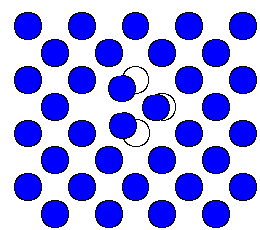 Aber: Dies geschieht in aller Regel nicht! Leerstellen (und auch, soweit bekannt, ZGA), sind relativ scharf lokalisiert. Experimentell läßt sich dies messen, denn je ausgedehnter eine atomare Fehlstelle ist, desto mehr Atome in ihrer Umgebung schwingen anders und ändern damit die Entropie (siehe Kapitel 2.1.1). Ausnahmen bestätigen die Regel - die Ausnahme bildet (als Regel) das Silizium. |