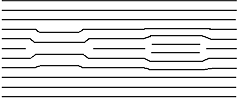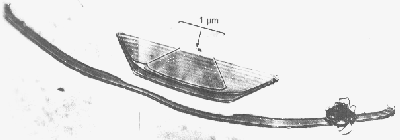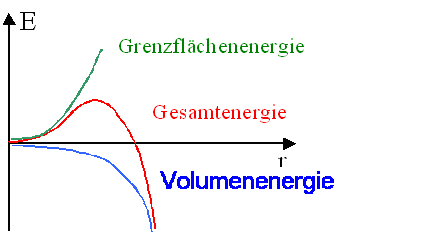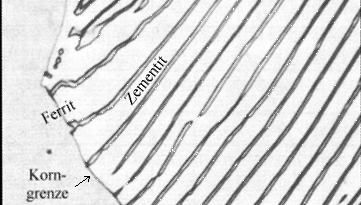|
Zwischen allen Defektarten bestehen enge Beziehungen. |
|
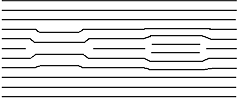 |
Defekte sind oft korreliert und treten gemeinsam auf.
Aus "kleinen" Defekten können
"große" Defekte entstehen |
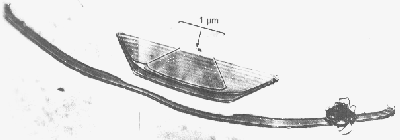 |
|
|
 |
Atomare Fehlstellen lagern sich zu zweidimensionalen (Stapelfehler) oder dreidimensionalen
Agglomeraten (Ausscheidungen, Voids) zusammen. | |
|
 |
Zweidimesionale Defekte sind von eindimensionalen Defekten (= Versetzungen) begrenzt. |
|
|
 |
Ausscheidungen sind von Phasengrenzen umgeben. |
|
|
 |
Phasen- und Korngrenzen enthalten spezielleVersetzungen. |
|
|
| |
| |
 |
Entascheidend für die Bildung größerer Defekte ist die Keimbildung. | |
|
|
 |
Bei der Bildung einer Ausscheidungen mit Radius r konkurrieren z.B. Energieabsenkung
durch Verringerung der Punktfehlerübersättigung (µr3)
mit der Energieerhöhung durch die notwendige Phasengrenze (µr2). |
|
|
 |
Für kleine Ausscheidungen (= Keime) ist die Energiebilanz ungünstig; es existiert
eine Energiebarriere. | |
|
 |
Durch Manipulation dieser Energiebarriere können Ausscheidunge vermieden oder bewußt
gefördert werden. | |
| | |
| |
 |
Die Gesamtheit der Kristallgitterdefekte in ihrer spezifischen Anordnung heißt
das Gefüge des Materials. |
|
|
|
 |
Etwas eingeschränkter und basierend auf der Historie, ist das Gefüge das, was man
im Lichtmikroskop nach geeigneter Anätzung (= Sichtbarmachung) von Gefügebestandteilen sieht. |
|
|
 |
Im Bild sieht man beispielsweise die langezogenen Fe3C Ausscheidungen in
Stahl (Zementit Lamellen) sowie eine Korngrenze. Was man nicht sieht sind Versetzungen und Punktdefekte im bcc Eisen
(= Ferrit). | |
© H. Föll (MaWi 1 Skript)